
Das Bundeskleingartengesetz, auch als BKleinG bezeichnet, befasst sich mit den Regularien für deutsche Kleingärten. Damit die Regeln des Bundeskleingartengesetzes auf einen Garten anwendbar sind, muss dieser nichterwerbsmäßig gärtnerisch genutzt werden, insbesondere der Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf und für die Erholung dienen sowie in einer Kleingartenanlage mit gemeinschaftlichen Einrichtungen liegen (§ 1 Absatz 1 Bundeskleingartengesetz). Gleichwohl regelt das Gesetz auch, was gerade nicht als Kleingarten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes dient. Dazu gehören u.a. Wohnungsgarten, Arbeitnehmergarten und Grabeland.
Inhaltsverzeichnis
- Die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit
- Der Schrebergarten und das Gartenhaus
- Der Pachtvertrag
- Das Bundeskleingartengesetz regelt auch die Höhe der Pacht
- Der Pächter kann nach der Kündigung eine Entschädigung verlangen
- Verein kann unliebsame Pächter nicht so einfach loswerden
- Auch die Vereinssatzung sollte berücksichtigt werden
- Ohne Bundeskleingartengesetz und Vereinsordnung wäre kein Zusammenleben möglich
Die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit
In § 2 Bundeskleingartengesetz ist die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit geregelt. Demnach ist ein Kleingartenverein dann als gemeinnützig anzusehen, wenn das Ziel des Vereins ausschließlich oder überwiegend die Förderung des Kleingartenwesens sowie die fachliche Betreuung der Mitglieder ist, die erzielten Einnahmen kleingärtnerischen Zwecken zugeführt werden und bei der Auflösung des Vereins dessen Vermögen für kleingärtnerische Zwecke verwendet wird.
Der Schrebergarten und das Gartenhaus
Wer einen Kleingarten pachtet, möchte diesen natürlich möglichst nach seinen eigenen Vorstellungen und Ideen gestalten. Sowohl die Verordnung des jeweiligen Kleingartenvereins als auch das Bundeskleingartengesetz selbst können hier jedoch Beschränkungen vorgeben. So befasst sich § 3 Bundeskleingartengesetz beispielsweise mit der Gartenlaube. So darf ein Gartenhaus nur in einfacher Ausführung errichtet werden und nicht mehr als 24 Quadratmeter an Grundfläche umfassen, inklusive des überdachten Freisitzes. Zudem darf die Laube nicht als dauernder Wohnsitz genutzt werden. In Sachen Ausstattung und Einrichtung sollte die Gartenlaube im Schrebergarten also nicht das eigene Wohnhaus übertreffen.
Auch was den Kleingarten an sich betrifft, finden sich entsprechende Regularien im Bundeskleingartengesetz. So darf der Schrebergarten nicht größer als 400 Quadratmeter sein. Zudem gilt es, bei der Nutzung und Bewirtschaftung des Kleingartens die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.
Der Pachtvertrag
Der zweite Abschnitt des Bundeskleingartengesetzes befasst sich schließlich mit den Regeln über die Pachtverträge für den Kleingarten. Demnach können Pachtverträge nur schriftlich vereinbart werden. Und auch eine Kündigung ist nur in schriftlicher Form gültig. Gemäß § 6 Bundeskleingartengesetz können Kleingartenpachtverträge nur auf unbestimmte Zeit geschlossen werden. Befristete Verträge gelten demnach als auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Der Verpächter ist nur in bestimmten Fällen dazu berechtigt, das Pachtverhältnis zu kündigen. Dies ist dann der Fall, wenn der Pächter seiner Zahlungsverpflichtung nicht nachkommt, wenn es zu schwerwiegenden Pflichtverletzungen seitens des Pächters gekommen ist, oder wenn einer der in § 9 Bundeskleingartengesetz genannten Sonderfälle vorliegt.
Das Bundeskleingartengesetz regelt auch die Höhe der Pacht
Wer einen Schrebergarten sein Eigen nennen will, muss zunächst Mitglied im jeweiligen Kleingartenverein werden. Durch diesen werden Mitgliedsbeiträge erhoben, die der Pächter zu entrichten hat. Der Pachtvertrag wird zwischen dem Kleingartenverein und dem Pächter geschlossen. Aus dem Pachtvertrag geht auch die Höhe der Pacht hervor. Für angehende Pächter dürfte an dieser Stelle interessant sein zu wissen, dass durch den Kleingartenverein keine astronomisch hohen Summen gefordert werden können. Denn das Bundeskleingartengesetz regelt in § 5, dass der Pachtzins nach oben hin auf das Vierfache der ortsüblichen Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau zu begrenzen ist.
Hier ist auch der Hintergrund des Gesetzes zu sehen. Denn der ursprüngliche Gedanke war, sozial schwachen Personen und Familien die Möglichkeit zu bieten, eigenes Gemüse und Obst anzupflanzen. So sollte es ihnen möglich sein, Geld für Nahrungsmittel zu sparen und sich besser selbst zu versorgen. Daher ist es wichtig, die Pacht für einen Schrebergarten möglichst niedrig zu halten, um es weiterhin Personen aus allen Gesellschaftsschichten zu ermöglichen, sich ihren Wunsch nach einem eigenen Stück Garten zu erfüllen.
Der Pächter kann nach der Kündigung eine Entschädigung verlangen
Sollte der Verpächter einen Kleingartenpachtvertrag aus anderen Gründen als einer Pflichtverletzung des Pächters ordentlich kündigen, besagt das Bundeskleingartengesetz, dass dem Pächter hieraus ein Anspruch auf eine angemessen Entschädigung erwächst. Und zwar bezieht sich dieser Anspruch auf diejenigen Pflanzen oder Anlagen, die der Pächter im Rahmen einer üblichen kleingärtnerischen Nutzung eingebracht hat. Gut zu wissen: Anders als bei den mietrechtlichen Vorschriften des BGB tritt die Verjährung dieses Anspruchs nicht schon nach 6 Monaten nach Beendigung des Pachtvertrages ein. Die Verjährungsdauer beträgt laut Bundesgerichtshof hier vielmehr 3 Jahre.
Verein kann unliebsame Pächter nicht so einfach loswerden
Die Kleingartenvereine sind sehr daran interessiert, dass alle Pächter sich an die Regeln der Vereinsordnung halten, um ein angenehmes Miteinander zu ermöglichen. Dennoch ist es auch bei groben Verstößen nicht so leicht, unerwünschte Pächter wieder loszuwerden. Der Verein kann das Pachtverhältnis kündigen. Hierdurch tritt nach Ende der Kündigungsfrist der Verlust des Pachtrechts für den Pächter ein. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass er automatisch nicht mehr Besitzer der Parzelle ist. Denn laut Gesetz ist er vielmehr noch so lange als Besitzer anzusehen, bis eine freiwillige Rückgabe des Gartens erfolgt, oder es dem Verein möglich ist, eine Räumungsklage zu erzielen und der Gerichtsvollzieher die rechtmäßigen Besitzverhältnisse wieder herstellen kann. Dies jedoch kann in der Praxis sehr zeitintensiv sein.
Auch die Vereinssatzung sollte berücksichtigt werden
Das Bundeskleingartengesetz bildet also ein wichtiges Grundgerüst, sowohl für Pächter als auch Verpächter. An den Regularien des Gesetzes orientieren sich die Kleingartenvereine. Für den Pächter sollte aber auch immer Bedeutung haben, die jeweilige Satzung zu lesen, die das Vereinsleben genauer regelt. Dort finden sich beispielsweise genauere Angaben zu den Ruhezeiten oder zu den zulässigen Höhen der Hecken. Im Zweifel sollte zudem immer Rücksprache mit dem Vorstand gehalten werden, möchte man Veränderungen an seiner Parzelle vornehmen. Zwar kann es sein, dass eine Maßnahme durchaus per Gesetz erlaubt ist, die Satzung kann hierzu aber noch spezielle Anmerkungen bereithalten. Bevor man sich also als Pächter allein auf das Bundeskleingartengesetz verlässt, sollte man sich immer beim Vorstand des Vereins rückversichern.
Ohne Bundeskleingartengesetz und Vereinsordnung wäre kein Zusammenleben möglich
Die detaillierten Regelungen, die im Bundeskleingartengesetz sowie in der Vereinsordnung zu finden sind, sind durchaus erforderlich. Denn in einer Kleingartenanlage leben die Pächter vergleichsweise eng bei-, neben- und miteinander. Dies ist ein deutlicher Unterschied zu gewöhnlichen Gärten von Nachbarn. Hierdurch entsteht eine stärkere Gemeinschaft, die schlichtweg gewisser Regelungen bedarf, um zu funktionieren und Bestand zu haben. Pächter sollten sich daher auch mit der für die meisten eher unliebsamen Gesetzesmaterie befassen und einen Blick in Bundeskleingartengesetz und Vereinsordnung werfen. Dies kann manch einen Fauxpas im kleingärtnerischen Zusammenleben vermeiden.



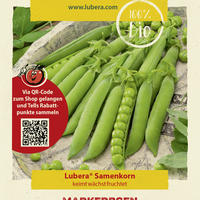







 Lubera Originale sind exklusive Lubera® Sorten, die von Lubera entweder gezüchtet oder erstmals auf den Markt gebracht worden sind.
Wer Lubera Originale kauft, bekommt die doppelten Tells®-Äpfel (=Rabatte für die nächste Bestellung) gutgeschrieben.
Lubera Originale sind exklusive Lubera® Sorten, die von Lubera entweder gezüchtet oder erstmals auf den Markt gebracht worden sind.
Wer Lubera Originale kauft, bekommt die doppelten Tells®-Äpfel (=Rabatte für die nächste Bestellung) gutgeschrieben.
 Beim Kauf dieser von Lubera gezüchteten Lubera Original-Pflanze erhalten Sie die doppelten Tells gutgeschrieben.
Tells® werden grundsätzlich aufgrund des fakturierten Nettobetrags berechnet (1 Tells für volle 25 Euro/sFr).
Bei doppelten Tells wird am Schluss nochmals der Wert der Tells-Originale dazugerechnet und die neue Summe für die Berechnung der Tells benutzt.
Beim Kauf dieser von Lubera gezüchteten Lubera Original-Pflanze erhalten Sie die doppelten Tells gutgeschrieben.
Tells® werden grundsätzlich aufgrund des fakturierten Nettobetrags berechnet (1 Tells für volle 25 Euro/sFr).
Bei doppelten Tells wird am Schluss nochmals der Wert der Tells-Originale dazugerechnet und die neue Summe für die Berechnung der Tells benutzt.
Gibt es Im Kleingartengesetz, eine Preisgrenze für Kleingarten
oder ist es erlaubt, einen Garten für
30 000€ zu verkaufen, obwohl das Gutachten 4025€ sagt?
In diesem Falle ist es eine Genossenschaft die dennoch der Kleingärtnerischen Nutzung dient